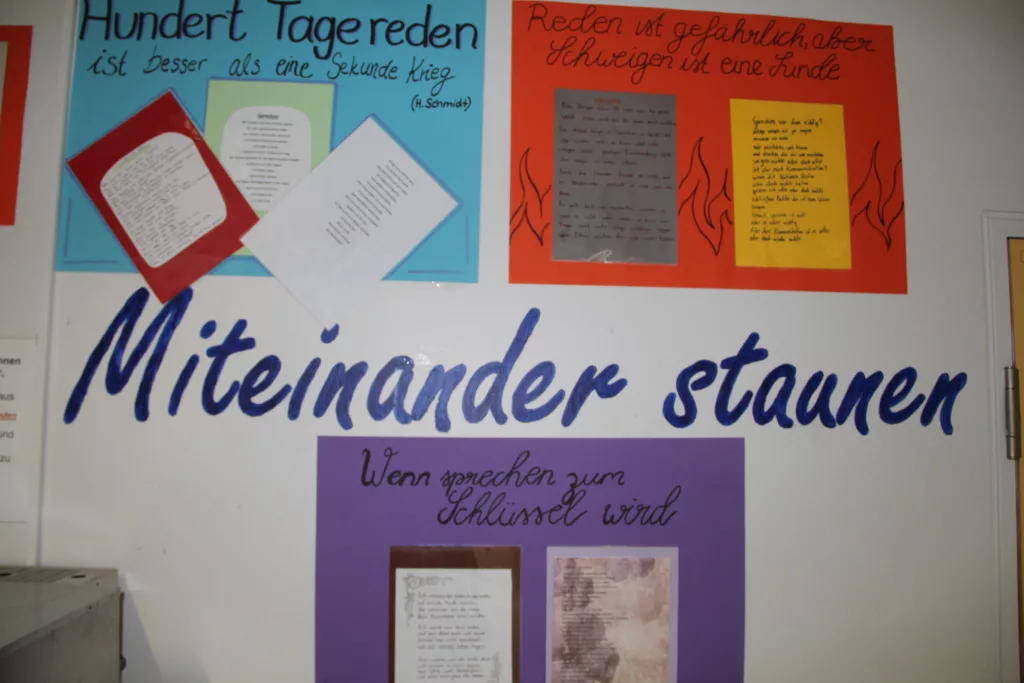Geschichtlicher Schwerpunkt
Der geschichtliche Schwerpunkt...
…gibt den Schülern der Goetheschule die Möglichkeit Geschichte hautnah zu erleben. Durch zahlreiche Kooperationen haben die Goetheschüler die Möglichkeit ab dem 6. Jahrgang Exkursionen zu geschichtlichen Themen zu unternehmen und selbstständig Projekte zur Erweiterung der eigenen Erinnerungskultur zu erarbeiten. Ein kleine Auswahl unserer Arbeit der letzten Jahre können Sie in der folgenden Chronik betrachten.
Die neusten Beiträge

Grabstein auf dem Friedhof Groß-Zimmern wird entfernt

Zeitzeugengespräch mit Henriette Kretz

Exkursion des Jahrgangs 10 nach Buchenwald und die Goethestadt Weimar

G9b skypt mit 84-jähriger Amerikanerin

Beschädigter Gedenkstein – Gefangenenfriedhof Klein-Zimmern

Volkstrauertag 2021 – G10d und Chor Melody in der Paulskirche

GoetheschülerInnen erinnern an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren